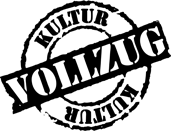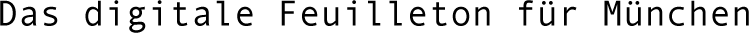Kultur-Interview mit OB Christian Ude (Folge I)
"Bayerns Bilanz ist Sanierungsstau, Verfall und eine Kulturschande"
Er ist der Schwabinger Schöngeist, der seit 1993 München regiert. Der SPD-Politiker Christian Ude ist wohl der kulturaffinste Regent aller deutschen Großstädte, auch wenn das Verhältnis zur Szene in den letzten Jahren Risse bekommen hat. Bei der bayerischen Landtagswahl 2013 tritt Ude gegen Horst Seehofer (CSU) an. Hier ist Teil 1 eines Gesprächs über die Sünden der Staatsregierung, die überraschende Stärke der Münchner Games-Entwickler und die Frage, warum Social Media an den Kammerspielen auch ein bisschen Notwehr ist.
Herr Ude, die Münchner Kulturpolitik war immer ein Aushängeschild ihrer Arbeit als Oberbürgermeister. Warum spielt die Kulturpolitik eine so kleine Rolle, wenn es um die Frage geht, wer künftig Bayerns Geschicke lenken soll?
Christian Ude: Der Stellenwert einer Fachpolitik hängt immer auch davon ab, ob es einen großen Nachholbedarf gibt oder nicht. Als ich 1990 als Bürgermeister anfing, war die Situation in München durch einen großen Nachholbedarf gekennzeichnet. Es gab keine Pinakothek der Moderne in München, obwohl die schon der Münchner Bürgermeister Ritter von Borscht 1906 gefordert hatte. Es gab keinen Kunstbau am Königsplatz, sondern nur die aus allen Nähten platzende Villa des Lenbachhauses. Die Stuckvilla war genauso dem baulichen Verfall ausgesetzt wie es die Kammerspiele im Schauspielhaus waren. Es war unklar, ob das Theater der Jugend in der Schauburg überhaupt erhalten werden kann, ebenso das Volkstheater. Und das sozialdemokratische Versprechen von Stadtteilkultur war bis dahin nur in einigen winzigen Pionierfällen wie der Seidlvilla in Schwabing eingelöst worden, aber nicht auf breiter Front. Deshalb gab es damals, als ich anfing als Kulturbürgermeister und später als Oberbürgermeister, eine Menge zu tun. Hier war ein riesiges Investitionsprogramm zu realisieren und ein riesiges Sanierungsprogramm obendrein. Dazu die wichtigen personellen Weichenstellungen nach der Ära Celibidache bei den Philharmonikern und die seitdem schon wiederholt gestellte Frage nach der Nachfolge bei der Intendanz an den Kammerspielen...
Heißt das nun, dass die Verhältnisse bei der Kultur in Bayern aus Ihrer Sicht alle geregelt sind?
Natürlich gibt es in Bayern auch kritische Fragen, die sich jetzt langsam in der öffentlichen Wahrnehmung aufhäufen. Aber sie haben noch nicht den entscheidenden Stellenwert erhalten. Man realisiert jetzt die Probleme durch den Sanierungsstau nicht nur bei den Universitäten, sondern auch bei den Museen. Es gibt, gerade wenn ich nach Bayreuth blicke, einen erschreckenden Sanierungsbedarf bei geradezu verfallenden Kulturbauten. Es gibt die Frage, ob kommunale Kultureinrichtungen ohne staatliche Mitträgerschaft lebensfähig und überlebensfähig sind - hier hat sich der Freistaat in einigen Fällen schon positiv bewegt. Es gibt aber keine übergreifende große Kontroverse, wie mit den großen Kulturinstituten umzugehen ist und wie neue Kulturbewegungen unterstützt werden können. Deshalb vollzieht sich eine kritische Diskussion eher am Beispiel von einzelnen Themen: etwa das Amerikahaus in München. Das halte ich für eine richtige Kulturschande, dass ein Haus, das dem amerikanische Volk als Dank gewidmet worden ist für die Befreiung vom Faschismus, jetzt seine Funktion verlieren soll - weil ein sehr spesenfreudiger Verein sich das gerne unter den Nagel reißen möchte!
In das Amerikahaus soll Acatech einziehen, die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften. Dafür hat sich der Ex-BMW-Chef Joachim Milberg sehr stark bei Ministerpräsident Horst Seehofer eingesetzt...
Eben, es ist eine Verabredung zwischen zwei Männern, die das fern jeder Öffentlichkeit wohl per Handschlag geregelt haben. Und es zerstört den räumlichen Zusammenhang in der Maxvorstadt, den wir doch mit dem NS-Dokumentationszentrum herausstellen wollen, übrigens gemeinsam getragen von Bund, Land und Stadt: Wir wollen zeigen, dass dies ein historisch kontaminiertes Areal ist, auf dem die Führerbauten stehen und das Braune Haus gestanden hat. Wo aber auch der Aufbruch zur Demokratie architektonisch Gestalt angenommen hat - ganz bewusst an diesem Platz durch das Amerikahaus.
Vor kurzem wurde eine Studie vorgestellt, die den üblichen Münchner Superlativen einen überraschenden hinzufügt: Die Stadt sei deutsche Spitze bei der sogenannten Kultur- und Kreativwirtschaft. Was bedeutet das, außer dass sich eine freie Kulturszene die Stadt noch weniger als ohnehin schon leisten kann?
Es ist zunächst mal eine gute Nachricht, dass München bei der Kultur-und Kreativwirtschaft eine fast einsame Spitzenstellung in Deutschland hat. Und - das wissen wir aus einer anderen Untersuchung - zu den Top Ten in Europa zählt, neben Weltstädten wie London, Paris, Madrid. Das erfreut auch deshalb, weil es zeigt, das München keine Monostruktur hat, somit also nicht vollkommen von der IT-Branche oder der Automobilbranche abhängig wäre. Dazu haben wir einen starken Tourismus und ein starkes Handwerk. Eine breite Streuung ist wichtig für die Stadt, denn jede Branche kann auch mal in Schwierigkeiten geraten. Das haben wir bei der Automobilbranche schon erlebt, es konnte Gott sei Dank überwunden werden. Vor gar nicht langer Zeit haben wir es beim Bankensektor erlebt, bei den Versicherungen Gott sei Dank noch nicht. Eine Krise kann jede andere Branche auch heimsuchen. Und wenn wir nun feststellen, dass in den letzten Jahren und fast unbemerkt eine weitere starke Branche herangewachsen ist, dann finde ich das sehr vorteilhaft.
Was hat Sie am meisten überrascht?
Kultur- und Kreativwirtschaft macht nicht nur Umsätze und bietet Arbeitsplätze, sondern fördert auch das kulturelle Leben und die Vielzahl der Lebensentwürfe in einer Stadt. Für mich war am überraschendsten, dass das Gebiet außerhalb der Stadtgrenzen genauso großes Potenzial hat wie die Stadt selbst. Das hätte kein Mensch erwartet! Es geht dabei nicht um öffentlich subventionierte Einrichtungen wie Kammerspiele oder Residenztheater! Sondern ausschließlich um den Wirtschaftszweig, in dem Unternehmer und Beschäftigte ihren Lebensunterhalt verdienen. Rundfunkbranche, Filmwirtschaft, Zeitungsbranche, Privattheater - da denken wir Münchner doch, das wäre alles im Münchner Stadtgebiet. Aber das stimmt überhaupt nicht! Das Fernsehen ist zum Großteil schon draußen, die kreisfreien Städte haben sehr viel zu bieten. Und Existenzgründer von kreativen Brachen wie digitalen Games oder IT-Software sind ohnehin tätig, wo sie wollen.
Gar kein Wermutstropfen?
Es gibt einen wichtigen Punkt, den man auch selbstkritisch sehen muss, denn Kreativwirtschaft wird unterschiedlich definiert. Manche halten nur die Künstler selbst für kreativ, andere zählen Zeitungsverlage samt Anzeigenabteilung oder IT mit allen Ingenieuren dazu. Hier ist München auf jeden Fall sehr stark. Das, was aber kreativ im engeren Wortsinne ist, also die Künstlerszene mit Musikern, Bildhauern, Malern und so weiter, das ist in München nicht so stark, wie wir uns das wünschen würden. Hier sehen wir die Kehrseiten des wirtschaftlichen Erfolgs: Flächenmangel, Raummangel und Immobilienpreise, die für junge Künstler ein Gräuel sind.
Kultur in der Stadt entsteht, wenn es Kommunikation über Kultur gibt, also zum Beispiel das Wechselspiel zwischen Aufführung und Kritik. Wie sehen Sie die aktuelle Lage des Münchner Kulturjournalismus'?
Nun, er selbst wird sich geschwächt und vernachlässigt vorkommen. Das ist sicher tatsächlich so, wenn man mit früheren Jahrzehnten vergleicht. Er ist aber nach meiner Beobachtung immer noch stärker als in anderen Städten, weil es hier einen öffentlich-rechtlichen Rundfunksender gibt, der einfach schon vom Personalbestand und Umsatz her das größte Kulturinstitut Bayerns ist. Wir haben hier fünf Zeitungen, von denen immerhin vier regelmäßig über Kultur berichten und sie kommentieren. Das ist im Städtevergleich sehr viel. Aber trotzdem spielte der Kulturjournalismus in früheren Jahren eine größere Rolle. Das liegt unter anderem daran, dass Printmedien ganz generell neue Konkurrenz erhalten haben, mit der sie sich die öffentliche Aufmerksamkeit teilen müssen.
Viele Münchner Kulturinstitutionen, etwa die Kammerspiele oder das Haus der Kunst, setzen nicht mehr auf die Printmedien und suchen nach neuen Formen der Kommunikation zum Publikum, vor allem über Social Media. Können diese tatsächlich zu einem Ersatz werden oder wird hier einfach aus einer Art Notwehr heraus gehandelt, weil Kulturjournalismus nicht mehr oder immer weniger stattfindet?
Es trifft beides zu. Zum einen wird versucht, einen Mangel zu beheben. Und man nimmt die Chance zu einer direkten Kommunikation wahr, die es so früher ja gar nicht gegeben hat. Bei den Kammerspielen gibt es außerdem nicht nur den digitalen Versuch, eine interessante Webseite zu bieten und in den sozialen Medien präsent zu sein. Sondern den meiner Meinung nach inhaltlich und sozialpolitisch viel bedeutsameren Versuch, in die Stadtviertel zu gehen und mit Menschen, die fern von Kulturinstituten aufwachsen, Verbindung aufzunehmen. Das ist in einigen atemberaubend spannenden Fällen geschehen. Hier geht es nicht darum jetzt alles online zu versenden, weil die Zeitung nichts mehr schreibt, sondern eine bildungsbürgerliche Arroganz in Musentempeln zu überwinden. Das Signal lautet: Wir werden von der gesamten Stadtgesellschaft getragen, dann müssen wir auch auf die gesamte Stadtgesellschaft zugehen. Davon werden nicht alle begeistert sein, es werden nicht alle etwas damit anfangen können. Aber im Prinzip muss das kulturelle Angebot allen gemacht werden - in der Hoffnung, dass dann möglichst viele darauf eingehen.
Im Netz gibt es seit einiger Zeit die Seite "Museen-in-München", mit der auch der Kulturvollzug kooperiert. Auf dieser Seite wird die institutionelle Grenze zwischen Stadt und Freistaat eingerissen, hier werden alle Institutionen zusammengebracht. Wäre das in der realen Welt nicht auch überfällig?
Dieser Versuch einer gemeinsamen Informationspolitik, der jetzt endlich gelingt, wurde von mir schon 1991 als Kulturbürgermeister gefordert. Damals habe ich alle Geschäftsführer und Direktoren der Kulturinstitute des Staates und der Stadt eingeladen. Und es war eigentlich damals schon so, dass die Vertreter aller Institute ohne Scheuklappen an einer Kooperation interessiert waren - solange sie sich davon einen Vorteil versprechen konnten.
Und so lange keine Ressentiments im Wege stehen...
Vor allem ging es wohl darum, das war meiner Erinnerung nach bei den Museen der Fall, dass einige große die Sorge hatten, es könnten auch einige kleinere mit aufs Silbertablett springen, die man nicht als gleichwertige Mitanbieter ansehen wollte. Auf einer Ebene wie beispielsweise Lenbachhaus-Stadtmuseum konnte man sich verständigen, aber dass dann auch einige kleinere Private vom gemeinsamen Auftritt profitieren möchten, haben damals die staatlichen Pinakotheken absolut nicht goutieren können. Ähnlich war es bei den Theatern. Die Grenze verlief nicht so sehr zwischen Stadt und Staat, sondern hier galt es, die freie Szene fernzuhalten. Ich halte das für inakzeptabel, wenn man sich heute zum Beispiel die Qualität eines Metropoltheaters anschaut - das gehört für mich zu den innovativsten Theaterensembles der Stadt. Warum sollte man diese Bühnen wegen ihrer privaten Rechtsform von einem gemeinsamen Auftritt der Theaterlandschaft fernhalten?
Folge 2 des Interviews mit OB Christian Ude finden Sie hier und Folge 3 hier.